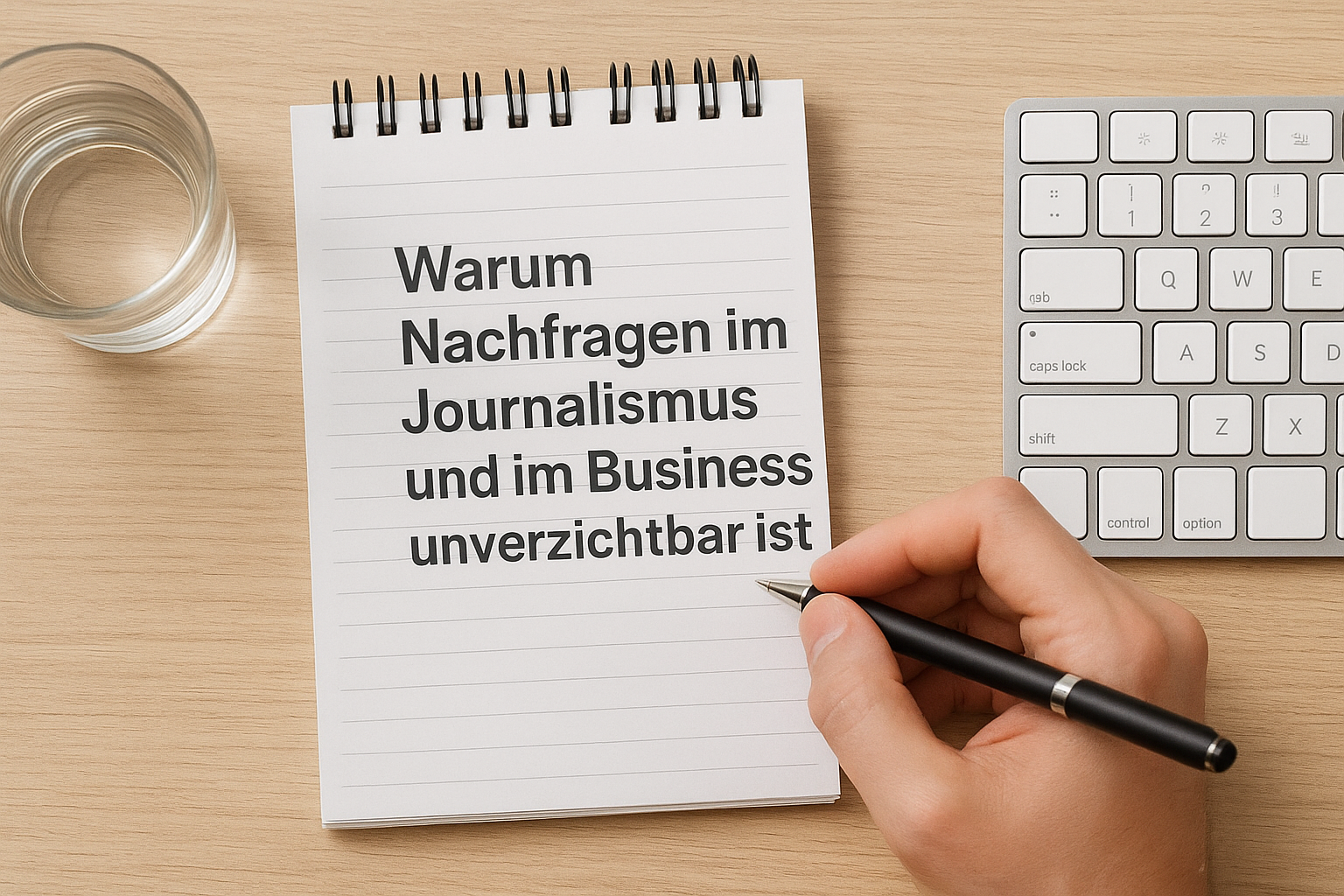Im Journalismus ist es üblich, dass nachgehakt wird. Sind Aussagen nicht genau so, wie wir sie haben wollen, fragen wir nach, um eine präzisere Antwort zu erhalten. Das ist unser Job. Warum es existenziell und notwendig ist, erkläre ich in diesem Beitrag.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!In aktuellen Zeiten, wo Überschriften und Zitate gekürzt werden, ist das Nachfragen wichtiger denn je. Es sorgt nicht nur für eine korrekte Berichterstattung, sondern auch für Vertrauen zwischen Journalisten und Gesprächspartnern.
Ein journalistischer Text muss alle W-Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Das ist klar. Aber wie gehen Journalisten dabei vor und was kann die Presseabteilung tun, um so wenig Nachfragen wie möglich zu generieren? Denn schließlich sind auch die Zeiten bei Pressekonferenzen begrenzt. Hier muss gut vorgearbeitet werden. Erfahrene PR-Agenturen wissen, was für Fragen aufkommen können und wie sie diese (meist unangenehmen) Fragen vermeiden können.
Warum Nachfragen für Journalisten unverzichtbar ist
Als Journalistin bin ich auf vielen Presseveranstaltungen unterwegs und habe daher viel erlebt, weshalb es Zeit wird, einmal das Nachfragen erklären. Warum fragen wir nach? Ganz einfach: Wir wollen Themen verstehen. Besonders, wenn wir uns in dem Bereich nicht auskennen. Ein Vor-Ort-Termin ist daher mehr, als einfach nur Zitate sammeln und diese dann am heimischen Schreibtisch hintereinander zuschreiben.
Es geht darum, das Thema zu verstehen – nicht, um jemanden mit einer Frage bloßzustellen, obwohl das je nach Sympathiewert auch passieren kann. Daher lieber nett und freundlich zu einem Journalisten sein, anstatt sich mit ihm anzulegen. Und eines noch: Journalisten merken sich, ob man ihnen etwas zu Essen oder zumindest ein Getränk angeboten hat.
Wie Nachfragen Missverständnissen vorbeugt
Grundlegend ist das Nachfragen allerdings unser Job. Mit Nachfragen zeigen wir Interesse an der Person und beugen so Missverständnissen vor. Natürlich hat jeder Journalist – je nach Termin – seine Standardfragen, die er abfragt. Da kann es passieren, dass jemand zu genau hinhört und dann doch eine kritische Frage stellt. Dann wurde genau zwischen den Zeilen hingehört und dabei eine widersprüchliche Aussage entdeckt.
Genau hier geraten Menschen, die wenig mit Medien zu tun haben, ins Schwimmen. Sie haben nicht damit gerechnet, dass dem Gegenüber etwas aufgefallen ist, was eventuell kritisch werden könnte. Durch das Nachfragen besteht allerdings die Möglichkeit, sich noch einmal klarer auszudrücken und ein Missverständnis aus der Welt zu räumen.
Wie durch Vertrauen echtes Interesse entsteht
Es kann auch passieren, dass nachgefragt wird, wenn eine Aussage nicht klar formuliert oder die Frage eventuell missverstanden wird. Dann wird die Frage einmal präziser formuliert oder erklärt, worauf der Fragesteller hinaus will. Manchmal wird die Frage an anderer Stelle auch anders formuliert, um die notwendigen Informationen zu bekommen. Das ist völlig normal.
Im besten Fall kennt sich der Journalist mit dem Thema aus und es entsteht ein einfaches Gespräch, in dem sich Notizen gemacht oder es einfach mitgeschnitten wird. Vielleicht wurde sich hier auch gut vorbereitet, denn Journalisten wollen Geschichten auf ihre Art und Weise erzählen. Nach Möglichkeit finden sie noch einen anderen Zugang zu dem Thema. Man kommt ins Fachsimpeln oder erzählt einfach mal aus dem Leben, wo man mit dem Thema schon einmal in Berührung gekommen ist. Das erzeugt Vertrauen.
Nachfragen bedeutet redaktionelle Verantwortung
Warum Journalisten nachfragen? Sie haben eine redaktionelle Verantwortung. Die Zitate müssen korrekt sein, sonst entstehen Fehler, die für den Journalisten fatal werden können. Noch schlimmer ist es für den Befragten. Im schlimmsten Fall entsteht eine Rufschädigung. Da diese – egal, ob absichtlich oder nicht – öffentlich passiert, kann eine Hexenjagd entstehen. Dadurch kann eine Person ihren Arbeitsplatz und das soziale Umfeld verlieren. Es handelt sich hier um extreme Folgen, die auch für den Journalisten nicht ohne sind. Anzeigen sind dann die Konsequenz.
Allerdings hat auch der Interviewte die Verantwortung, präzise Antworten zu geben. Nur, wenn es als Gespräch geführt wird, und die Antworten gut durchdacht sowie fundiert sind, kann ein gut recherchierter Text entstehen. Der Befragte hat also auch mit seinen Antworten ebenfalls einen Einfluss darauf, wie eine Berichterstattung ausfällt.
Ich bin jemand, der im Vorfeld seinem Gegenüber sagt, worüber gesprochen wird und in welcher Form berichtet wird. So vermeide ich unangenehme Folgen für mich und den Interviewpartner.
Wie Nachfragen im Business-Kontext wirkt
Diese Technik kann auch im Businessbereich angewendet werden, um wichtige Details in der Auftragsarbeit abzuklären. Nachfragen ist also nicht nur eine Angewohnheit von Journalisten. Es lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen – etwa wie auf die Kommunikation zwischen Auftraggeber und Dienstleister. Hier werden Details zum Auftrag abgefragt, um den nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen. Ein einfaches „Was ist Ihnen/dir wichtig?“ zeigt nicht nur Interesse, sondern vermittelt auch sehr gut die Werte der Auftraggeber/Person sehr gut vermittelt. Stimmungen werden abgefangen, um eine authentische Kommunikation aufzubauen.
Die wichtigsten Gründe fürs Nachfragen
- Nachfragen zeigt echtes Interesse und will niemanden Bloßstellen.
- Es geht darum, die Informationen zu verstehen, anstatt nur zu zitieren.
- Die Kommunikation wird dadurch klar und präzise.
- Vertrauen wird aufgebaut.
- Redaktionelle/unternehmerische Verantwortung.
Nachfragen ist kein Zeichen von Misstrauen, sondern ein Ausdruck von Professionalität – nicht nur im Journalismus, sondern auch im Geschäftsleben. Wer fragt, zeigt Interesse, verhindert Missverständnisse und legt den Grundstein für Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Gerade im Zeitalter von KI-generierten Texten und Deepfakes wird das menschliche Nachfragen immer wichtiger. Es gibt Kontext, Emotion und Verantwortung, die keine Maschine ersetzen kann.