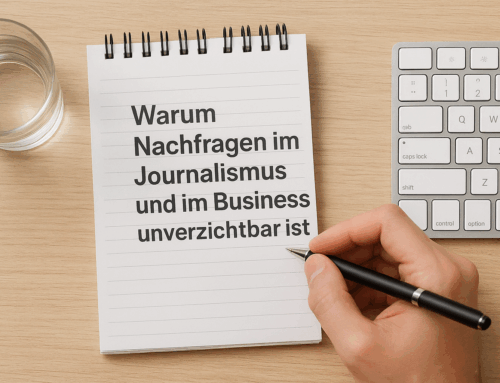Worauf beim Schreiben eines Berichtes geachtet werden muss. Dabei sind nicht nur die W-Fragen wichtig, sondern auch die Struktur.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Stell dir vor, du bist auf einer Pressekonferenz und musst danach einen Bericht schreiben. Aber wie sollst du dann beim Schreiben vorgehen? Und welche Anforderungen muss der Text erfüllen? Da das nicht immer ganz einfach ist, hier ein kleiner Überblick.
Der Bericht ist im Journalismus die gängigste Darstellungsform. Er ist in vielen Varianten zu finden. Und doch ist sein Aufbau gleich. Überschrift, Teaser, Vorspann (erster Absatz), Zwischenzeile, Einstieg ins Geschehen aka Hauptteil mit Zwischenzeilen und Schluss sind dabei einfach zu berücksichtigen. Dazu müssen die wichtigsten W-Fragen beantwortet werden. So kann sich der Leser einen Überblick über den Inhalt machen und entscheiden, ob er weiterlesen will.
W-Fragen müssen im Bericht beantwortet werden
Erst einmal ist es wichtig, dass die W-Fragen beantwortet werden. Es muss schnell ersichtlich
werden, worum es geht. Also muss folgendes beantwortet werden:
- wer (Protagonist(en))
- was (hat stattgefunden?)
- wann (hat es stattgefunden?)
- wo (hat es stattgefunden?)
- weshalb (hat es stattgefunden?)
- warum (hat es stattgefunden?)
- wie (macht die Person; wie ist das passiert; läuft die Veranstaltung ab usw.)
Achtung: nicht jede W-Frage muss beantwortet werden. Aber die ersten vier sind elementar wichtig. Genauso, wie, als wenn du bei der Feuerwehr oder Polizei anrufst. Die fragen auch nach den wichtigsten Doch nicht nur die W-Fragen müssen beantwortet werden. Texte haben, gerade, wenn es sich um Berichte handelt, einen bestimmten Aufbau. Im Online-Bereich müssen sie dazu noch gut verschlagwortet sein, um gefunden zu werden. Am einfachsten lässt es sich mit dem Zuruf-
Prinzip erklären. Stell dir vor, du bist in einer Küche und rufst jemandem etwas zu.
Überschrift
Die Struktur ist einfach und startet mit einer Überschrift. Diese muss so kurz sein, dass der Leser sofort weiß, worum es geht. Beispiel: „Gib mir mal das Salz“
Der Teaser
Ein Teaser verdichtet die Überschrift noch einmal. Er erklärt das Thema in zwei bis drei knackigen Sätzen oder maximal 165 Zeichen, die so prägnant sind, dass der Leser mehr wissen will. Oder der Küchenhelfer aufgrund der Geräuschkulisse nicht genau versteht, worum es sich handelt. Es muss also verdichtet werden. In dem Beispiel: „Gib mir mal das Salz, damit ich das Fleisch würzen kann. Ohne Salz schmeckt das Gericht nicht.“ Es können noch kleinere Fragen übrig gelassen werden, damit der Leser weiterhin neugierig bleibt. Bisher hat der Küchenhelfer schon einmal den Überblick, dass das Fleisch gewürzt werden muss, aber nicht, um was für ein Fleisch es sich handelt.
Der erste Absatz
Im ersten Absatz wird der gesamte Text zusammengefasst. Er besteht jetzt aus vier bis fünf Sätzen, in denen der begriffsstutzige Küchenhelfer genauere Anweisungen erhält. Beispiel: „Gib mir mal die Mühle mit dem Meersalz. Die ist da oben links, wo XY steht. Ohne dieses Salz schmeckt das Steak nicht und die Gäste laufen weg.“
Zwischenzeilen sind nicht nur für Google wichtig
Nach dem ersten Absatz folgt die erste Zwischenzeile. Diese fasst die nächsten beiden Absätze genauer zusammen. Wichtig ist hier, dass die mit den wichtigen Schlagworten versehen ist. Man kann sie als kleine Zwischenrufe verstehen. Mit ihnen wird genauso gearbeitet, wie mit der Überschrift. Kurz, prägnant und auf den Punkt kommend. Sie wird alle zwei bis drei Absätze platziert, um dem Leser eine Orientierung zu geben.
Ab dem zweiten Absatz wird in den eigentlichen Text eingestiegen
Mit dem zweiten Absatz beginnt quasi die Geschichte. Hier ist der Anlass wichtig. Im Küchenbeispiel könnte das eine Geschichte über den Geschmack von Salz sein und wie was am besten gewürzt wird. Bedeutet, die Protagonisten erzählen aufgrund der Grillsaison (aktueller Anlass), welche Fehler beim Salzen von Speisen gemacht wird und wie man sie vermeidet. Auch wird erklärt, welches Salz wofür am besten verwendet werden kann. Vielleicht wird auch noch erklärt, wie Salz gewonnen wird. Bedeutet, der Text muss einen Mehrwert liefern.
Alle zwei, drei Absätze, wird eine Zwischenzeile eingefügt. Die Absätze haben außerdem eine Länge von vier bis fünf Sätzen. Im Online-Bereich gilt diese Länge als gut lesbar und verständlich.
Wichtig ist: Pro Satz lediglich zwei, drei wichtige Informationen unterzubringen, da sich der Leser nicht mehr pro Satz merken kann. Die Sätze sind nicht durch zu viele Kommata getrennt, die den Lesefluss stören. Auch entscheidend ist das Tempo. Lange und kurze Sätze werden am besten gemischt, da diese das Tempo des Textes bestimmen. Kurze Sätze erhöhen das Tempo, lange verlangsamen es.
Der Schluss im Bericht
Neben dem Hauptteil braucht ein Text einen Schluss. Dieser soll beim Leser einen Aha-Moment oder einen Seufzer auslösen. Ein Aha-Moment entsteht, wenn der Text genügend beibringt, ohne dass noch Fragen offen sind. Der Seufzer entsteht in der Regel bei Texten, die mit Menschen zu tun haben. So Geschichten sind nah am Menschen dran und sollen dem Leser das Gefühl geben, dass er eine schöne Geschichte gelesen hat. Bei Veranstaltungen darf sich der Leser gerne mal in
den Hintern beißen, dass er nicht da war.
Möglich ist auch, dass unser Leser Informationen bekommt, wo er sich melden kann, wenn es sich beispielsweise um eine Mitmachtaktion handelt. Achtung: Es ist kein klassischer Call-To-Action in Form von „Jetzt hier anmelden und lernen, wie Salz am besten verwendet wird.“
Tipps zum Schreiben eines Berichtes
- laut vorlesen. Hier merkst du, wo es am Text noch hapert.
- den Text eine Zeit lang liegen lassen und danach noch einmal gegenlesen. Für die eigenen Texte ist man oft sehr schnell blind.
- immer erst den gesamten Text herunterschreiben. Es ist einfacher, Teaser, Vorspann, Überschrift und Zwischenzeilen erst zum Schluss zu machen, wenn du weißt, in welche Richtung der Text geht.
SEO – Suchmaschinenoptimierung im Bericht
In den Zwischenzeilen sind Keywords, also Suchbegriffe, untergebracht. Diese werden auch gezielt im Text platziert. Aber bitte kein Keywordspamming. Google straft das ab. Die richtige Zeit für einen Bericht ist grundlegend das Präsenz und Konjunktiv 1 (ist gewesen). Mit diesen Zeiten wirkt der Text aktiver und der Leser hat das Gefühl, dabei zu sein. Genau das, was am Ende bei einem Bericht herauskommen soll. Der Leser soll selbst Bilder in den Kopf bekommen und sich Sachen vorstellen können.
Wichtig ist, dass der Bericht sachlich, neutral und korrekt ist. Eine werbliche Sprache ist entsprechend verboten. Hierunter fallen Superlative wie „besonders“. Ist das gelungen, liegt ein ausführlicher Bericht vor einem, der informiert und am Ende noch einen Lerneffekt hat.