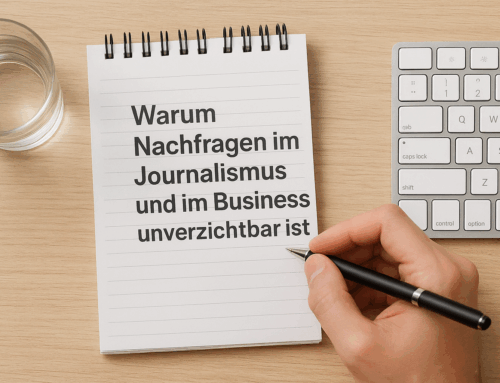Als ich vor einiger Zeit einen Text gelesen habe, in dem es um die Essen Motor Show und deren Absage geht, gelesen habe, suggerierte die Überschrift, dass die Messe aufgrund eines Sturms abgesagt werden sollte. Ich stutzte und las mir den Text durch. Nein, das ist nicht der Journalismus, den ich lebe. Es ging lediglich um Absperrbänder, die das Fotografieren erschweren. Keine Namen genannt. Ich schüttelte den Kopf und schreibe nun diesen Text: Woran man Fake News erkennt oder auch die erfundene Geschichte im Journalismus.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Dass der Journalismus inzwischen einen schlechten Ruf hat, ist leider bekannt und mir blutet da das Herz, weil es keinen schöneren Beruf gibt. Allerdings, bei dem, was ich teilweise von Reichweiten orientierten Portalen lese, wird mir schlecht. Nicht nur, dass Clickbaiting betrieben wird, die Überschriften sind so gewählt, dass der Leser völlig falsche Erwartungen hat. In dem Fall habe ich das Wetter suggeriert, aber nicht einen Fotografen, der sich über die Absperrbänder aufregt.
Ja, die Absperrungen sind auf der Essen Motor Show normal, damit die Fahrzeuge nicht so einfach angefasst werden können. Aber dies mit einem Sturm gleichzusetzen, ist völlig aus dem Kontext gerissen. Hier hätte der Autor konkreter sein können, in dem er auf den zu erwartenden Besucheransturm hinweist. Aber wo wäre da der Aufreger geblieben, damit der Text geklickt wird? Wie gesagt, das Portal lebt von der Reichweite.
Recherchequalität
1. Namen werden immer genannt
Ein wichtiges Kriterium, um den Wahrheitsgehalt einer Geschichte zu überprüfen, ist die Quellenangabe. Hier sind Namen unerlässlich. Dies ist ein sicheres Indiz dafür, dass der Autor selbst mit der Person gesprochen hat – selbst die Bild-Zeitung macht dies.
2. Wenn Namen zwar bekannt, aber nicht genannt werden dürfen/sollen
Das kommt tatsächlich öfters vor, als man denkt. Man spricht mit einer Person und diese möchte zwar, dass die Geschichte erzählt wird, aber nicht genannt werden. Hier hat man mehrere Möglichkeiten: Entweder man ändert den Namen, weil die Person Ärger bekommen kann und nutzt die Formulierung „Name der Redaktion bekannt“ oder man nutzt die Formulierung „möchte nicht genannt werden“. Dann ist man als Journalist fein raus.
3. Immer die Gegenseite benennen
Auch das ist ein Faktor, der dazu führt, dass die Recherche gut ausgeführt ist. Es gilt ebenfalls, dass der Name der Gegenpartei genannt werden muss – selbst wenn es die Pressestelle ist. Hier reicht die Formulierung „laut Veranstalter“ nicht immer. Auf wessen Aussage wird aber bezogen? Ist die Person, die zitiert wird, wirklich berechtigt, Auskunft zu erteilen? Dies muss auch klar sein, wenn man als recherchierender Journalist die Geschichte aufnimmt, sich auch auf Aussagen einer bestimmten Person beziehen kann.
4. Aussagen müssen durch Zitate belegt sein
Nun ist, in diesem Fall, noch ein weiterer Fall passiert, der für eine Fake-Geschichte spricht, passiert: Die Aussage, dass Fahrzeuge beschädigt wurden, ist nicht von einem Eigentümer belegt worden. Zwar kann eine Aussage des Veranstalters auch gültig sein, allerdings muss dies durch entsprechende Formulierungen wie „laut Aussage des Veranstalters“ gekennzeichnet sein.
5. Mindestens zwei Personen müssen im Text genannt und zitiert werden – drei sind besser
Zwei Personen sind schon einmal ein wichtiger Faktor dafür, dass man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat – alles andere ist PR. Drei Stimmen von unterschiedlichen Personen sind besser, um die Stimmung abzubilden. Zwar ist dies aufwendiger, aber von der Recherche her die sichere Variante, ohne dass man seine Autorität verliert.
Natürlich sind dies nur Indizien, dass ein Text wahrscheinlich kalt zusammengeschrieben wurde. Sicher ist man nur, wenn man die Recherchebelege einfordert. Und das kann man selten machen und der normale Bürger weiß dies nicht.
KI verstärkt Fake News – nicht nur bei Texten
Und doch wird es aufgrund von künstlicher Intelligenz immer deutlicher, dass sich Nachrichten immer schneller verbreiten. Die Recherchequalität nimmt ab und alles muss schnell veröffentlicht werden. Das ist nicht nur im Textbereich so, sondern auch bei Bildern. Gerade hier wird es immer einfacher, sich inzwischen fotorealistisches Material erstellen zu lassen. Oftmals erkennt man diese Bilder schnell, weil sie sehr weichgezeichnet sind und die Lichtverhältnisse nicht ganz in die Atmosphäre passen. Manchmal sind auch Gliedmaßen zu viel oder zu wenig vorhanden.
Vor einiger Zeit ging ein Video viral, in dem ein Orca seine Trainerin während einer Show getötet haben soll. Nach ein wenig Recherche hat es weder den Vorfall noch Trainerin und Orca gegeben. Bei dem Video hat es sich um ein KI-generiertes gehandelt. Die Bildrate war etwas zu hoch, was zu einem flüssigen Bewegungsablauf von Trainerin und Tier geführt hat.
Im Text lässt sich es anhand der oben stehenden Indizien sehr gut nachweisen. Dazu kommt, dass nicht jede Aussage auch geprüft wird. ChatGPT selbst weist darauf hin, dass es Fehler machen kann. Wahrscheinlich, um zu verhindern, dass Fake News entstehen. In meinem Beitrag rund um KI gehe ich auf diese Problematik genauer ein.
Alles in allem muss man sich eine kritische Denkweise angewöhnen und noch genauer hinzuschauen. Genau das ist die Aufgabe von Journalisten.